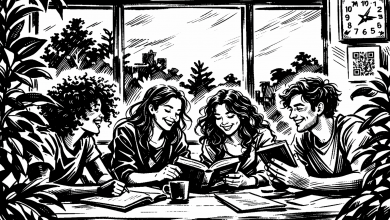Ab 2027 werden Gemeinden mehrwertsteuerpflichtig – was Bürger darüber wissen sollten
Rosmarie Brosig von Bürger für Gilching hat sich des Themas angenommen
Gilching – Rosmarie Brosig, Gemeinderätin der Fraktion „Bürger für Gilching“, ist bekannt dafür, dass sie nicht locker lässt, sieht sie einen ideellen wie finanziellen Vorteil für Bürger, generell aber hinterfragt sie Maßnahmen, die allgemein der Gemeinde zugute kommen. So hakte sie immer wieder mal unter Punkt Verschiedenes im Gemeinderat nach, inwieweit die Kommune auf das Jahr 2027 vorbereitet ist, dann nämlich, wenn tatsächlich eine Mehrwertsteuer für alle gemeindlichen Liegenschaften wie Kindergärten, Sportplätze, Schulen, Turnhallen, Musikschule, Veranstaltungssaal wie auch für die Räumlichkeiten der Vhs sowie für entsprechende Tätigkeiten eingeführt wird. Da das Thema scheinbar noch nicht so richtig angekommen ist, stellte stanet.de Rosmarie Brosig einige Fragen:
Ab 2027 müssen Städte und Gemeinden in Deutschland bei vielen Leistungen, für die sie Geld verlangen oder als geldwerten Zuschuss gewähren, die Mehrwertsteuer (MWSt) gesondert auf der Rechnung ausweisen – so wie es auch Unternehmen tun. Grund dafür ist eine neue gesetzliche Regelung, die schon 2015 beschlossen wurde und nun endgültig in Kraft tritt.
Stanet: Was ändert sich für Bürger?
Brosig: Für die Bürger bleibt alles beim Alten: Der Preis, den sie zahlen, bleibt derselbe. Ob der Betrag als „inklusive Mehrwertsteuer“ oder als „Nettopreis plus Mehrwertsteuer“ auf der Rechnung steht, macht am Ende keinen Unterschied. Es geht hier also vor allem um die Art und Weise, wie die Gemeinde ihre Rechnungen ausstellen und intern mit dem Finanzamt abrechnen muss.
Stanet. Warum wird das gemacht?
Brosig: Die Neuregelung soll sicherstellen, dass Gemeinden nicht besser gestellt sind als Unternehmen in der freien Wirtschaft, wenn beide ähnliche Leistungen anbieten – zum Beispiel bei der Vermietung von Turnhallen oder Veranstaltungsräumen. Das Ziel ist ein fairer Wettbewerb.
Stanet: Was bedeutet das für die Gemeinde?
Brosig: Die Gemeinde muss künftig genau unterscheiden:
· Behördliche Aufgaben wie das Ausstellen von Ausweisen bleiben weiterhin steuerfrei.
· Wirtschaftliche Tätigkeiten wie die Vermietung einer Halle oder der Verkauf von bestimmten Dienstleistungen werden steuerpflichtig.
· Kleinere, unwichtige Einnahmen können weiterhin unter bestimmten Bedingungen steuerfrei bleiben.
Die Umstellung bedeutet für die Verwaltung einiges an Arbeit. Es müssen alle Einnahmen geprüft und korrekt zugeordnet werden. Bei Unsicherheiten wird oft ein Steuerberater hinzugezogen.
Stanet: Wo liegt die Chance?
Brosig: Durch die neue Regelung darf die Gemeinde auch die Vorsteuer, die sie selbst bei Einkäufen bezahlt, vom Finanzamt zurückfordern – etwa bei Bauprojekten oder Anschaffungen. Das spart anfangs viel Geld und kann die Gemeindekasse deutlich entlasten. Wichtig ist jetzt, zügig zu handeln, damit mögliche Rückerstattungen noch rechtzeitig beantragt werden können. Denn: Verpasste Fristen können teuer werden!
Brosigs Fazit: Die neue Umsatzsteuerpflicht bringt zwar organisatorische Aufgaben mit sich, bietet der Gemeinde aber auch die Chance, bei Investitionen spürbar zu sparen – ein Vorteil, der letztlich auch allen Bürgerinnen und Bürgern zugutekommt.
In der jüngsten Sitzung erklärte dazu Bürgermeister Manfred Walter: „Die Umsetzung wird seit Jahren verschoben, weil keiner genau weiß, wie dann dieses Umsatzsteuerrecht angewendet werden soll. Es wird aber kommen und erhebliche Auswirkungen auf die Nutzer der Einrichtungen wie auch auf die Gemeinde haben.“ Voraussichtlich sollen dann unter anderem alle Gebäude an ein so genanntes Kommunal-Unternehmen übergeben werden. Walter: „Wie dann gewirtschaftet wird, entzieht sich unserem Zugriff. Es muss sich aber rechnen, was bedeutet, dass auch Gebühren für Mitglieder im Sportverein oder für Kinder im Kindergarten teurer werden.“